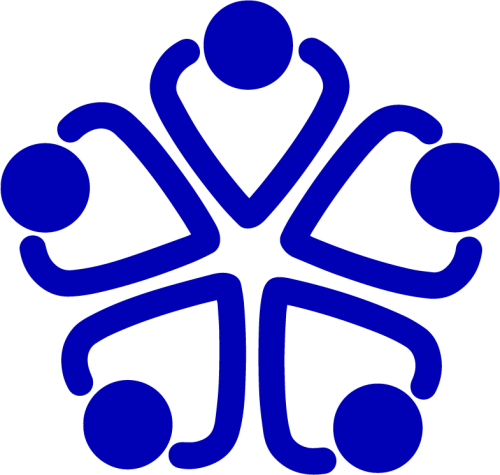FAQ zur VERAH, NäPA, PA und PCM
Häufig gestellte Fragen zur VERAH
Die VERAH (Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis) ist eine speziell weitergebildete MFA, die delegierbare Aufgaben von Hausärztinnen und Hausärzten übernimmt – z. B. Hausbesuche, Wundversorgung, Versorgungskoordination und Patientenschulungen.
Teilnahmeberechtigt sind medizinische Fachangestellte (MFA) mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung in einer hausärztlichen Praxis.
- Abgeschlossene Ausbildung zur MFA (Medizinische Fachangestellte)
oder - Abgeschlossene Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf, z. B.:
- Gesundheits- und Krankenpfleger/in
- Altenpfleger/in
- Notfallsanitäter/in (je nach Anbieter)
Wichtig: Die MFA-Ausbildung ist der Regelfall. Andere Berufsgruppen können nach Einzelfallprüfung durch den Weiterbildungsträger zugelassen werden.
Ein Quereinstieg zur VERAH (Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis) ist nur eingeschränkt möglich, da bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
- Ohne medizinische oder pflegerische Grundausbildung ist ein Einstieg in die VERAH-Qualifikation in der Regel nicht möglich.
- Die VERAH-Weiterbildung baut auf medizinischem Grundlagenwissen und Praxiserfahrung auf.
Empfehlung bei Quereinstiegsinteresse:
- Kontaktaufnahme mit dem anbietenden Bildungsträger (IHF) zur individuellen Prüfung der eigenen Voraussetzungen
- Ggf. könnte alternativ eine basismedizinische Qualifikation vorgeschaltet werden
Die Weiterbildung umfasst in der Regel 80 Stunden und wird in berufsbegleitenden Modulen angeboten. Die Dauer variiert je nach Anbieter zwischen 3 und 6 Monaten.
- Chronische Erkrankungen und Multimorbidität
- Hausbesuche vorbereiten und durchführen
- Kommunikation mit Patienten und Angehörigen
- Medikationsmanagement
- Wundversorgung
- Fallmanagement & Dokumentation
- Entlastung der Ärztin/des Arztes
- Verbesserte Patientenversorgung
- Bessere Praxisorganisation
- Teilnahme an besonderen Versorgungsprogrammen (z. B. HzV)
Ja! In Thüringen gibt es mehrere Optionen:
- Förderung durch die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVTh):
Zuschüsse für Praxen, die MFA zur VERAH weiterbilden - Qualifizierungschancengesetz (BA):
Übernahme von Kurskosten + Gehaltszuschuss während der Weiterbildung - Vergütung über HzV-Zuschläge:
VERAH-Einsätze werden zusätzlich honoriert
Kurse zur VERAH-Weiterbildung werden regelmäßig von zertifizierten Anbietern angeboten, z. B.:
- Hausärzteverband Thüringen (in Kooperation mit dem IHF)
- Landesärztekammer
- Bildungswerke des Gesundheitswesens
- Online-Schulungen mit Präsenzmodulen
Aktuelle Kursangebote vermittelt die Geschäftsstelle des Hausärzteverbandes Thüringen.
VERAH und NäPA sind beides Zusatzqualifikationen für Medizinische Fachangestellte, die eine erweiterte Rolle in der hausärztlichen Versorgung übernehmen.
Der wesentliche Unterschied liegt im Umfang der Weiterbildung, den delegierten Aufgaben und den Einsatzmöglichkeiten:
- Die VERAH-Qualifikation ist eine Fortbildung, die MFA befähigt, den Hausarzt bei der Versorgung von Patienten – insbesondere älteren, chronisch kranken und multimorbiden – zu unterstützen. Sie übernimmt delegierbare Aufgaben, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsberatung, Organisation von Hausbesuchen oder Dokumentation.
- Die NäPA-Qualifikation baut auf der VERAH auf und erweitert deren Kompetenzen. NäPAs dürfen bestimmte ärztlich definierte Leistungen eigenständig – insbesondere im Rahmen von Hausbesuchen – durchführen. Die Weiterbildung ist umfangreicher und entspricht den Anforderungen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) zur Teilnahme an speziellen Förderprogrammen.
Kurz gesagt:
Die VERAH ist eine wichtige Grundlage für eine qualifizierte Patientenbetreuung in der Hausarztpraxis. Die NäPA ergänzt diese Qualifikation durch ein noch breiteres Spektrum an Aufgaben mit besonderem Fokus auf selbstständige, delegierte Tätigkeiten außerhalb der Praxis. Zudem ist die Weiterbildung zur VERAH auf den Einsatz in Hausarztpraxen ausgerichtet, die Weiterbildung zur NäPA qualifiziert hingegen dazu auch in anderen Bereich tätig zu werden.
- Blutdruck-/Blutzuckerkontrolle
- Verbandswechsel
- Injektionen (nach Anweisung)
- Hausbesuche
- Patientenschulungen
- Organisation von Versorgungsabläufen
- Unterstützung bei DMPs und Chronikerprogrammen
Wichtig: Alle Aufgaben müssen ärztlich delegiert sein und im Rahmen gesetzlicher Vorgaben erfolgen.
- MFA über Inhalte und Ablauf informieren
- Kursanbieter auswählen
- Fördermöglichkeiten prüfen (z. B. über KV Thüringen)
- Anmeldung & Vertrag abschließen
- Nach erfolgreichem Abschluss: Zertifikat wird ausgestellt
Häufig gestellte Fragen zur NäPA
Die Nicht-ärztliche Praxisassistentin (NäPA) ist eine qualifizierte Medizinische Fachangestellte (MFA), die nach einer erweiterten Fortbildung bestimmte delegierbare Leistungen außerhalb der Praxis - insbesondere Hausbesuche - selbstständig durchführen darf. Sie entlastet Hausärztinnen und Hausärzte vor allem in der Betreuung von chronisch kranken, älteren oder multimorbiden Patienten.
Die NäPA-Weiterbildung richtet sich an medizinische Fachangestellte (MFA) mit einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung in einer hausärztlichen Praxis. Voraussetzung ist in der Regel die vorherige Qualifikation als VERAH® oder eine vergleichbare Fortbildung.
NäPAs dürfen definierte, ärztlich delegierbare Leistungen außerhalb der Praxis erbringen, darunter:
- Hausbesuche bei stabilen Patienten
- Erhebung von Anamnesen und Vitalzeichen
- Durchführung von standardisierten Assessments
- Wundkontrollen und Verbandswechsel
- Medikamentenkontrolle und -beratung (im Rahmen der Delegation)
- Unterstützung bei der Organisation der Versorgung
- Dokumentation und Rückmeldung an die Ärztin oder den Arzt
Wichtig: Alle Tätigkeiten erfolgen auf ärztliche Anordnung und innerhalb des delegationsfähigen Rahmens.
Die Weiterbildung umfasst zwischen 170 Stunden und 271 Stunden und besteht aus theoretischen und praktischen Teilen. Die Dauer hängt von der Berufserfahrung ab. Die Weiterbildung kann berufsbegleitend absolviert werden und muss innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen sein. Die praktische Fortbildung findet in der Regel in Form von Hausbesuchen statt.
Die Inhalte sind bundesweit durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) geregelt.
- Abrechnungsfähige Leistungen im Rahmen der hausärztlichen Versorgung
Finanzielle Förderung durch die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVTh) - Zeitliche Entlastung der Ärztin/des Arztes bei Routinebesuchen
- Verbesserung der Patientenversorgung, vor allem im ländlichen Raum
- Integration in Programme wie DMP, HZV oder strukturierte Hausbesuchsversorgung
Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVTh) fördert sowohl die Weiterbildungskosten als auch die spätere Tätigkeit der NäPA:
- Zuschüsse zu den Weiterbildungskosten
- Förderung der Tätigkeit
- Abrechnungsmöglichkeit für durchgeführte Hausbesuche
Die genauen Fördersätze und Voraussetzungen erfahren Sie direkt bei der KV Thüringen oder über die Geschäftsstelle des Hausärzteverbandes Thüringen.
Zertifizierte Weiterbildungsanbieter in Thüringen und bundesweit – häufig in Kooperation mit Ärztekammern, Hausärzteverbänden oder Bildungswerken im Gesundheitswesen. Wichtig: Der Anbieter muss von der KBV anerkannt sein.
- Voraussetzungen prüfen (Berufserfahrung, VERAH-Zertifikat)
- Zertifizierten Kursanbieter auswählen
- Förderung über die KV Thüringen beantragen
- Weiterbildung absolvieren
- Tätigkeit der NäPA in die Praxisorganisation integrieren und abrechnen
Häufig gestellte Fragen zu PA / PCM
Bei beiden Berufen handelt es sich um akademisch ausgebildete Gesundheitsberufe.
- Ein PA ist qualifiziert zur ärztlich delegierten Mitarbeit in der Diagnostik, Therapie und Patientenversorgung. PAs arbeiten eng mit Hausärztinnen und Hausärzten zusammen und übernehmen Aufgaben, die ärztlich angeordnet, aber nicht zwingend vom Arzt selbst durchgeführt werden müssen. PA sind primär in der direkten Patientenversorgung tätig und unterstützen Ärzte bei medizinischen Aufgaben.
- PCM sind für die Organisation und das Management der Patientenversorgung in der Arztpraxis zuständig. Dazu gehören Aufgaben wie die Patientensteuerung, die Koordination von Terminen, die Verwaltung von Patientendaten und die Optimierung von Praxisabläufen.
Nein. Der PA ist kein Arzt, sondern ein unter ärztlicher Supervision tätiger nicht-ärztlicher Behandler. Er darf keine eigenständigen Diagnosen stellen oder Medikamente verschreiben – allerdings übernimmt er viele organisatorische und medizinisch-technische Tätigkeiten im Behandlungsprozess, soweit gesetzlich erlaubt.
- Anamnesegespräche & körperliche Untersuchungen
- Vitalzeichenmessung, EKG, Spirometrie, Labordiagnostik
- Erstellen von Vorbefunden und Behandlungsplänen (zur ärztlichen Kontrolle)
- Wundversorgung, Impfungen, Verbandswechsel
- Chronikerbetreuung & Präventionsberatung
- Dokumentation und Unterstützung bei DMPs und HzV
- Mitarbeit bei Hausbesuchen unter ärztlicher Delegation
Alle Tätigkeiten erfolgen unter ärztlicher Aufsicht und Verantwortung.
PA absolvieren ein Bachelorstudium (6–8 Semester) an einer Hochschule – meist in Vollzeit oder berufsbegleitend. Studienvoraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitsbereich (z. B. als MFA, Pflegefachkraft, Notfallsanitäter/in).
Das Studium kombiniert medizinisch-theoretische Inhalte mit praktischen Einsätzen in Kliniken und Praxen.
PCM absolvieren ein Bachelorstudium (5–7 Semester) an einer Hochschule – meist in Vollzeit oder berufsbegleitend. Studienvoraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitsbereich (z. B. als MFA, Pflegefachkraft, Notfallsanitäter/in), die Studiendauer ist abhängig von der Anrechnung der vorherigen Ausbildung (Berufsausbildung, VERAH, NäPA).
Der Beruf des PA ist derzeit nicht eigenständig geregelt, sondern basiert auf delegierbaren Tätigkeiten im Sinne des ärztlichen Berufsrechts (§ 28 SGB V, Delegation durch den Arzt). Die Abrechnung erfolgt über die Betriebsstätte des Arztes, nicht direkt durch den PA.
Ein bundesweites Berufsrecht oder Kammerstrukturen sind derzeit noch in Planung.
| Kriterium | Primary Care Manager (PCM) | Physician Assistant (PA) |
| Tätigkeitsschwerpunkt | Versorgungskoordination, Patientenmanagement, Praxisorganisation | Medizinisch-klinische Tätigkeiten, Delegation durch Ärzt:innen |
| Zielsetzung | Entlastung in Organisation, Vernetzung und Patientenführung | Entlastung bei diagnostischen und therapeutischen Aufgaben |
| Ausbildung | Akademische Ausbildung (i. d. R. Bachelor, B. Sc.) | Akademische Ausbildung (i. d. R. Bachelor/Master in PA) |
| Direkter Patientenkontakt | Ja, vor allem in Beratung und Koordination ) | Ja, inklusive Untersuchung, Diagnostik, Mitbehandlung (wie z. B. Sonographie, Langzeit-EKG, Infektions-Sprechstunde Débridement, Medikamenten Management |
| Medizinische Verantwortung | Keine, arbeitet unterstützend und organisatorisch | Ja, in Zusammenarbeit mit und unter Verantwortung von Ärzt:innen |
| Typische Aufgaben | Terminkoordination, Schnittstelle zu Fachstellen, Patientenbegleitung- und Beratung (Reha, Pflegeleistungen etc.) | Anamnese, körperliche Untersuchungen, Mitwirkung an Therapien |
PAs dürfen nicht selbst abrechnen. Alle Leistungen, die ein PA erbringt, müssen dem Arzt zugeordnet und über diesen abgerechnet werden. Eine direkte Förderung (wie bei NäPAs) gibt es derzeit nicht, allerdings profitieren Praxen durch Effizienzsteigerung und Entlastung.
Sowohl der PA, als auch der PCM können eine sinnvolle Ergänzung im Team sein, insbesondere bei hohem Patientenaufkommen, in ländlichen Regionen oder bei Personalengpässen. Sie sind besonders in größeren Hausarztpraxen, MVZs oder Berufsausübungsgemeinschaften gut integrierbar.
Aktuell gibt es keine bundesweit einheitliche Förderung für die Anstellung von PAs in Hausarztpraxen. In Einzelfällen kann es jedoch regionale Programme, Modellprojekte oder Unterstützung durch Kommunen, Krankenkassen oder Hochschulen geben.
Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband Thüringen setzt sich gegenüber Politik und Krankenkassen mit Nachdruck dafür ein, schnellstmöglich eine tragfähige Regelung zur Finanzierung beider Berufsgruppen zu erreichen.
In Thüringen gibt es einen Studienstandort für das berufsintegrierende Studium zum Physician Assistant, die ISBA Erfurt | Internationale Studien- und Berufsakademie in Erfurt. Das Studium zum PA wird in Kooperation mit Helios angeboten und ist berufsbegleitend möglich. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass das Studium zum Physician Assistant in Deutschland in der Regel an Hochschulen oder Akademien mit entsprechenden Studiengängen angeboten wird.
Studierende suchen oft nach Praxen für Praktika oder nebenberufliche Tätigkeiten. Der Hausärzteverband Thüringen kann bei der Vermittlung helfen.
Das Studium zum Primary Care Manager kann berufsbegleitend an der FOM Hochschule absolviert werden, dieses findet zu 70% digital statt.
Ein Highlight: Die Weiterbildung zur/zum Versorgungsassistent/-in in der Hausarztpraxis (VERAH) ist in den Studiengang integriert. Dies wird durch die Kooperation der FOM Hochschule mit dem Hausärztinnen- und Hausärzteverband sowie dem Institut für hausärztliche Fortbildung ermöglicht. Sollte die VERAH-Weiterbildung bereits zu Studienbeginn abgeschlossen sein, wird das Modul angerechnet. Ausgebildete medizinische Fachkräfte (mit oder ohne VERAH-Weiterbildung) steigen direkt ins 2. Semester ein.
Der Primary Care Manager stellt eine wertvolle Ergänzung in der hausärztlichen Versorgung dar. Als zentrale Schnittstelle zwischen Patient, Praxis und Versorgungsnetzwerk entlastet der PCM die Hausarztpraxis organisatorisch und unterstützt eine koordinierte, patientenzentrierte Betreuung. Damit trägt der PCM maßgeblich zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen und zukunftsfähigen Primärversorgung in Thüringen bei.
Kontakt & Unterstützung
Für weitere Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle des Hausärzteverbandes Thüringen gern zur Verfügung.
Telefon: 03621-706127
E-Mail: